| Vortrag anlässlich des 4. Friedrichshainer
Gesprächs, veranstaltet vom Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft
(IMEW) am 2. April 2003 in Berlin.
Jeder Mensch stirbt anders - Arzt-Patient-Kommunikation
am Lebensende
Linus S. Geisler
In seinen Tagebüchern stellt Max
Frisch eine Frage, die sich auch jeder Arzt stellen sollte: "Haben Sie
Freunde unter den Toten?" [1]
Doch wie erwirbt man Freunde unter
den Toten? Soll der Arzt überhaupt ein Freund seines Patienten sein?
Und wenn nicht, was dann: Behüter? Kompetenter technischer Experte?
Berater? Vielleicht sogar Lehrer?
Wenn jeder Mensch anders stirbt, muss
der Arzt nicht jedes Mal eine andere Rolle wahrnehmen? Gibt es nicht wenigstens
einige Regeln im Umgang mit Sterbenskranken, die immer gelten? Oder entsteht
jedes Mal bei der Begegnung von Arzt und Patient eine gänzlich neue
Form zwischenmenschlicher Beziehung, in der nicht nur ein hohes Maß
an Intimität und Ausgesetztsein existieren, sondern in der es im Extremfall
buchstäblich um Leben und Tode geht? So jedenfalls definiert der Philosoph
Peter Kampits die Arzt-Patient-Beziehung [2].
Und da es um das Sterben geht, sollte
auch das Ziel klar sein, das am Ende dieses Prozesses steht, also
die schwierige Frage, auf die es möglicherweise keine letzte Antwort
gibt: welcher Tod?
Welcher Tod?
Die Antwort lautet häufig: ein
guter Tod.
Damit tauchen neue Fragen auf. Was
ist ein guter Tod? Und was ein guter Arzt? Ein Arzt, der nicht nur gut
für das Sterben ist, sondern auch für das Leben. Denn Sterbende
sind Lebende. Als solche wollen sie wahrgenommen werden. Sterben ist letztlich
auch nur eine besondere Form des Zusammenlebens [3].
Und weiter: Setzt ein guter Tod ein
gutes Leben voraus? Kann, was ein gutes, ein gelungenes Leben im ganzen
ausmacht, stellvertretend von anderen definiert werden, zum Beispiel vom
Arzt?
Vielleicht findet sich bei Sören
Kierkegaard eine Antwort. Er schrieb: "Der Spaß, ein Menschenleben
für einige Jahre zu retten, ist nur Spaß, der Ernst ist, selig
zu sterben."
Möglichweise führt eine andere
Annährung an die Frage "welcher Tod?" weiter, nämlich: welcher
Tod auf keinen Fall? Rainer Maria Rilke hat diese Frage für
sich selbst sehr präzise beantwortet. Er sagte zu einer Freundin,
die auch bei seinem Sterben zugegen war: "... helfen Sie mir zu meinem
Tod, ich will nicht den Tod der Ärzte - ich will meine Freiheit
haben" [4]. Rilke, der an einer besonders schmerzhaften Form einer Blutkrankheit
litt, lehnte jede Einnahme schmerzstillender Mittel ab. Er hielt diesen
Entschluss bis zuletzt durch. Er tat dies offenkundig mit Bedacht, denn
ihm war ganz und gar nicht gleichgültig, wie er aus diesem seinem
Leben schied. Er wollte "seinen" Tod haben, "seinen" Tod sterben.
Wer seinen eigenen Tod, nicht den Tod
der Ärzte sterben möchte, will aber deswegen nicht auf sich gestellt,
alleine als "homo clausus", wie es der Philosoph Norbert Elias [5] nennt,
als Einsamer sterben.
Die Furcht Sterbender vor dem Tod
der Ärzte ist kontinuierlich mit der Technisierung der Medizin
gewachsen, ihrer zunehmenden Stummheit, ihrer dröhnenden Unruhe. Die
Mechanisierung des Sterbens in den Krankenhäusern der Moderne begann
bereits zu Anfang des vorigen Jahrhunderts. Rilke hat sie übrigens
in seinem Roman Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge treffend
beschrieben. Er spricht dort vom fabrikmäßigen Sterben
und dass der einzelne Tod nicht mehr so gut ausgeführt sei
[6]. Heute tut sich allerdings die Frage auf, ob nicht mancher Tod eher
zu
gut ausgeführt wird.
Was ein guter Tod ist, darum ist viel
gerungen und darüber ist viel geschrieben worden. Das British Medical
Journal hat im Januar 2000 eine ganze Ausgabe dem Thema "A good death"
gewidmet. In dem Editorial [7  ]
wendet sich der Herausgeber Richard Smith an die Leser des BMJ und empfiehlt
ihnen, falls sie es bisher nicht getan hätten, mit den Vorbereitungen
auf das Sterben zu beginnen. Immerhin würde jeder BMJ-Leser noch in
diesem Jahrhundert sterben. ]
wendet sich der Herausgeber Richard Smith an die Leser des BMJ und empfiehlt
ihnen, falls sie es bisher nicht getan hätten, mit den Vorbereitungen
auf das Sterben zu beginnen. Immerhin würde jeder BMJ-Leser noch in
diesem Jahrhundert sterben.
Das Editorial nennt zwölf Prinzipien
eines "guten Todes" [8]:
Prinzipien eines guten Todes
-
Zu wissen, wann der Tod kommt und
zu verstehen, was zu erwarten ist
-
Die Kontrolle über das Geschehen
zu behalten
-
Würde und Privatsphäre
zugestanden zu bekommen
-
Eine gute Behandlung der Schmerzen
und anderer Symptome
-
Die Wahl zu haben, wo man sterben
möchte (zu Hause oder anderswo)
-
Alle nötigen Informationen
zu bekommen
-
Jede spirituelle und emotionale
Unterstützung zu bekommen
-
Hospizbetreuung überall, nicht
nur im Krankenhaus,
-
Bestimmen zu können, wer beim
Ende dabei sein soll
-
Vorausbestimmen zu können,
welche Wünsche respektiert werden sollen
-
Zeit zu haben für den Abschied
-
Gehen zu können, wenn die
Zeit gekommen ist und keine sinnlose Lebensverlängerung zu
erleiden
|
|
Dieser Artikel löste eine wahre
Flut von ärztlichen Leserzuschriften aus. Sie reichten von völliger
Zustimmung bis zu kritischer Distanz und enthielten zusätzliche Anregungen.
Im Kern sind sie Ausdruck der Vielfalt der Haltungen und Wertvorstellungen,
die Ärzte unterschiedlichen Alters auf Grund ihrer Ausbildung, ihrer
Erlebnisse und ihrer Erfahrungen entwickelt hatten.
Diese Prinzipien eines guten Todes
lassen sich in drei Kategorien zusammenfassen. Sie reflektieren den Wunsch
nach Information, nach Autonomie und nach umfassender
Behandlung und Begleitung. In der Summe definieren sie also
die Kriterien des eigenen Todes und schließen eine
Schnittmenge mit jenem Sterben aus, der als Tod der Ärzte gefürchtet
wird.
In der klinischen Realität sind
diese Prinzipien untrennbar miteinander verzahnt. Das eine Prinzip ist
nicht ohne das andere zu verwirklichen. Ihre gemeinsame Matrix ist die
Beziehung
der in das Sterbegeschehen eingebundenen Personen, im engeren Sinn die
Beziehung zwischen Arzt und Patient. Die Natur dieser Beziehung wird durch
Kommunikationsabläufe bestimmt, wobei Kommunikation im weitesten Sinne
als jedes Verhalten in einer sozialen Situation zu verstehen ist.
Es geht also um den eigenen Tod.
Das bedeutet, dass Menschen Konzepte ihres Todes entwickeln können.
Es wird ein Antwort darauf gefunden werden müssen, welche Rolle in
diesem Prozess dem Arzt zufallen könnte, d.h. welche Form der Arzt-Patient-Beziehung
dabei die größte Aussicht hat, jeweils hilfreich zu wirken.
Dieser Versuch wird das Ende unserer
Überlegungen bilden.
Das Sterben
Jeder Mensch stirbt anders. In diesem
Sterben wirken viele Faktoren zusammen: die eigene Biographie, das Verständnis
von Krankheit und Gesundheit, die Erwartungen und Ansprüche des Einzelnen
und der Gesellschaft an die Medizin, das Lebens-, besser gesagt, Sterbensalter,
die Art der zum Tode führenden Krankheit, das Setting, in dem sich
das Sterben vollzieht.
Zu den "großen Krankheiten",
die das Sterben in einem besonderen, vielleicht sogar charakteristischen
Maß prägen, zählt der "Krebs" als Sammelbegriff einer Vielzahl
bösartiger Krankheiten. Krebs, diese Krankheit "in Anführungszeichen",
wie Adolf Muschg schreibt, ist "ein asozialer Prozess der biologischen
Norm" [9]. Ihn umgibt eine Aura des Tragischen, der Ohnmacht und der Entstellung,
des Unbegreiflichen. In ihrem Buch "Der Knoten" [10] beschrieb die krebskranke
Lieselotte Bappert Krebs "als Notlage, die sich schwerlich mit irgend etwas
vergleichen lässt, das einem zivilisierten Menschen sonst zustoßen
kann ..."
Es tauchen Fragen auf, auf die es scheinbar
keine Antwort gibt: "Wie kann man leben, wenn man weiß, dass man
bald sterben muss?"
Die Gewissheit des Sterbens hat die
Psychoonkologin Ursula Gruber in einem Bild beschrieben: Für den Kranken,
der weiß, dass er sterben muss, wird diese Gewissheit bildlich gesprochen
zum Hinterhof, der von der Hochleistungsmedizin ummauert wird. "Ihn betreten
zu müssen, heißt, den Kampf vor den Mauern schon verloren zu
haben und im Dunkel zu stehen - allein in Unbehagen und Angst".
Kampf, Angst und Dunkel
sind die häufigsten Vokabeln sterbenskranker Menschen.
Der letzte Satz in dem Buch "Mars"
von Fritz Zorn, einem jungen, reichen von Lymphknotenkrebs befallenen Mann
lautet: "Ich erkläre mich als im Zustand des totalen Krieges."
Ein junger Patient meiner früheren
Klinik, bei dem wir einen sich ungewöhnlich rasch ausbreitenden Krebs
der Bauchspeicheldrüse feststellen mussten, erklärte seinem Krebs,
"dieser Sau", wie er ihn voller Aggression nannte, wörtlich den Krieg
und war bis zu seinem raschen Tod derartig in diesen Kampf verstrickt,
dass uns kein Zugang zu ihm gelang.
"An Krebs zu denken," schrieb die mit
vierundvierzig Jahren an Brustkrebs gestorbene DDR-Schriftstellerin Maxie
Wander [11] "ist, als wäre man mit einem Mörder in einem dunklen
Zimmer eingesperrt. Man weiß nie, wo wie und ob er angreift."
Diese Angst ist ebenso gegen jenes
"gnadenlose Zuviel" einer technisch überrüsteten Medizin gerichtet,
wie gegen deren fast regelhafte Kehrseite, das "unbarmherzige Zuwenig".
Zu wenig an Zuwendung, Empathie und Präsenz der Betreuer. Viel Technik
und wenig Arzt, jetzt, wo doch genau das Gegenteil so bitter nötig
ist [12].
Das Unbekannte dominiert, nicht
selten in ambivalenter Weise, einerseits als Furcht vor dem Unbekannten,
andererseits als Hoffnung auf das rettende Unbekannte oder beides zugleich.
Dieses synchrone, für den Außenstehenden oft unerklärliche
Nebeneinander scheinbar widersprüchlicher Emotionen, Gefühle
und Verhaltensweisen, dem meist Prozesse der Verdrängung zugrunde
liegen, macht die Vordringlichkeit einer individuellen, flexiblen und nicht
schematisierten Einfühlung der Betreuer besonders deutlich.
So verdienstvoll auch die Abgrenzung
bestimmter charakteristischer Phasen im Sterben durch die Forschungen von
Elisabeth Kübler-Ross [13] gewesen ist, so deutlich muss auch klargestellt
werden, dass die Krankheitsverarbeitung keiner generalisierbaren
Abfolge von Phasen folgt. Dies ist die grundsätzliche Schwäche
des Konzepts von Kübler-Ross [14]. Sterbende müssen nicht
alle Phasen durchlaufen, geschweige denn in einer festen Reihenfolge.
Wechselnde Prozesse der Verdrängung
können Ursache für changierende (wechselnde) Wahrnehmungen der
Wirklichkeit sein. Das Recht auf Wissen ist ebenso verbürgt, wie das
Recht auf Nicht-Wissen. Nicht wenige Kranke aber schwanken in ihren Ansprüchen
zwischen diesen Rechten, manchmal von Tag zu Tag. An einem Tag wird das
Recht auf Wissen als Ausdruck der Autonomie als unverzichtbar erlebt, an
einem anderen Tag, sichert die "Gnade des Nicht-Wissen-Wollens" das Überleben.
Der erfahrene Begleiter wird versuchen, dieses Problem zu lösen, in
dem er den Patienten jeden Tag fragt: "Wie sehen Sie Ihre Lage heute?"
[15  ] ]
Die Vielfalt der Wertvorstellungen
und Lebensentwürfe, das Dominieren von Patchwork-Biographien, das
Phänomen, dass jeder seinen eigenen "Independence Day" zelebriert,
wie Peter Gross es in seiner Abhandlung Ich-Jagd [16] formuliert
hat, erweitert die Spielräume des Krankheitserlebens.
Dies alles verlangt vom Arzt eine höhere
Flexibilität und Sensibilität im Umgang mit Kranken in der letzten
Lebensphase als vor zwanzig oder dreißig Jahren. Es fehlt ein "Moral
Esperanto", auf das wir uns verlassen könnten (Jeffrey Stout [17]),
eine Art Welthilfsmoral zur Verständigung mit verschiedenen Positionen
und Weltanschauungen. Auch ein Rückgriff auf die evidenz-basierte
Medizin (EBM) lässt beim Begleiten Sterbender im Stich.
Mit anderen Worten: Sterben ist
ein hochindividualisiertes Geschehen, in dem die Wirklichkeit des Sterbenden
einem raschen, manchmal dramatischen Wechsel unterworfen sein kann. Dies
nicht zu erkennen und zu akzeptieren, kann tragische Folgen haben.
Sehr genau erinnere ich mich an einen
Patienten, wo mir dieser verhängnisvolle Fehler unterlaufen ist. Es
handelte sich um einen höheren Offizier mit einem weit fortgeschrittenen
Lungenkrebs, der bereits in Knochen, Leber und andere Organe metastasiert
war. Alle gängigen Behandlungsmöglichkeiten wie Chemotherapie
und Röntgenbestrahlung waren ausgeschöpft. Damals gab es eine
Strömung in der Medizin, Tumorpatienten möglichst umfassend aufzuklären.
Durch meine Mitarbeiter war der Patient über die Natur seiner Krankheit,
alle Details und die wahrscheinliche Prognose informiert. Er kannte sozusagen
jede einzelne Metastase nach ihrem Sitz und ihrer Größe. Bei
den Visiten zeigte er eine beinahe militärische Haltung, wirkte unerschütterlich,
klagte nicht, allenfalls machte er gelegentlich eine Bemerkung mit leicht
zynischem Unterton. Alles in allem war er ein Bild stoischer Gelassenheit.
Ich besuchte ihn außerhalb der
regelmäßigen Visite an einem warmen, ruhigen Sommerabend. Die
Situation wirkte friedlich, der Patient erschien entspannt und weniger
um Haltung bemüht als sonst. Damals beschäftigte mich die Frage
nach der seelischen Verarbeitung der fast schon rigorosen Aufklärung
von Krebskranken ganz besonders. Sehr vorsichtig fragte ich den Patienten,
ob ich ihm eine möglicherweise belastende Frage stellen könnte
und versicherte ihm gleichzeitig, dass ihm die Beantwortung völlig
freigestellt sei. Er stimmte sofort zu. Ich fragte ihn, wie er zu der weitreichenden
Information über seine Krankheit stehe und ob unser Vorgehen angemessen
gewesen sei. Ohne Zögern und in einem für mich absolut überzeugenden
Ton sagte er: "Wie ich informiert worden bin, war völlig in Ordnung!
Es war das einzig Richtige! Irgendwelche Halbwahrheiten hätte ich
nicht ertragen können." Ich war beruhigt und wir trennten uns in einer
fast freundschaftlichen Atmosphäre.
In diesem Augenblick wusste ich noch
nicht, dass ich einem buchstäblich tödlichen Irrtum erlegen war.
Gegen vier Uhr morgens rief mich der Diensthabende an und teilte mir mit,
der Patient habe durch einen Sprung aus einem Fenster im vierten Stock
der Klinik seinem Leben ein Ende gesetzt. Da fiel es mir wie Schuppen von
den Augen: Der Patient war bisher von Assistenzärzten aufgeklärt
worden. Der Krebsdiagnose mit allen ihren Konsequenzen fehlte sozusagen
die Bestätigung "in letzter Instanz" d.h. ein Irrtum und damit ein
Hoffnungsrest waren immer noch möglich. Meine Frage an ihn war diese
"letztinstanzliche Bestätigung" gewesen.
Zur Problematik des Autonomiebegriffs
Bei der Begleitung Sterbender geht
es um Würde, Autonomie und die Unantastbarkeit menschlichen
Lebens. Damit sind aber auch die Grundkonflikte abgesteckt, die sich
häufig erst in der konkreten klinischen Alltagssituation demaskieren.
Sie wurzeln unter anderem im Wandel der Medizin, der sich seit den 70er
Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts vollzogen hat.
Im heutigen Verständnis der Arzt-Patient-Beziehung
hat sich das Prinzip "Das Wohl des Kranken als oberstes Gesetz"
zum Prinzip "Der Wille des Patienten ist oberstes Gesetz" verschoben.
Die Autonomie des Patienten gewinnt Vorrang vor dem Prinzip der Fürsorge.
Der frühere Paternalismus, der dem Arzt die väterlich-bestimmende
Rolle zumisst, gilt als überholt. Als Ideal gilt der "mündige"
Patient, der aufgeklärt, eigenverantwortlich und selbstbestimmt die
Richtlinien seiner Behandlung vorgibt [18  ]. ].
Aber die Frage ist: will der umfassend
aufgeklärte Krebspatient bei der Entscheidung zwischen Chemotherapie
oder Bestrahlung tatsächlich auf sich selbst gestellt sein? Erlebt
er sich auch dann noch als "mündig" oder nicht doch zu allererst als
krank?
Wie rasch kann Selbstbestimmtheit in Sich-Selbst-Überlassensein umschlagen?
Schotsmans hat von der Fiktion einer Art "olympischen Selbstkontrolle"
gesprochen, zu der ein hinfälliger Kranker kaum (mehr) fähig
sein dürfte [19].
Wie viel "Mündigkeit" ist aber
zumutbar und wie hoch darf ihr Preis sein? Ein authentisches Beispiel:
Eine Patientin mit malignem Melanom schildert, wie der Oberarzt bei der
Ultraschalluntersuchung ihrer Leber einen zunächst unklaren Herd aufdeckt.
Ob das harmlos ist, will sie wissen. "An sich ja" kommt es prompt zurück.
Dann folgt - ohne die Patientin anzusehen - der Halbsatz, der ihr Leben
radikal verändern könnte: "... aber es kann natürlich genauso
gut eine Lebermetastase sein. Auf ihren entsetzten Blick hin entgegnet
der Arzt erstaunt: "Aber Sie sind doch eine mündige Patientin ..."
[20].
Wenn die Welt- und Menschenbilder,
vielleicht auch die Gottesbilder schlagartig zusammenstürzen, ist
das Aufrechterhalten einer stabilen Autonomie Illusion.
Autonomie ist auch nichts absolut Statisches,
sondern erweist sich, gerade in der Krankheit, als fluktuierend. Autonomie
kann nicht grenzenlos sein, wenn sie sich am Ende nicht gegen den Kranken
selbst richten soll.
Der Wille des Menschen, der eigene
eingeschlossen, ist immer nur ein mutmaßlicher. Der Wille von gestern
muss nicht der von heute, der von heute nicht der von morgen sein. Selbst
der Wille in der Frühe und am Abend, können sehr unterschiedlich
sein. Fluktuierende Wirklichkeiten sind im Verlauf der Krebskrankheit ein
häufiges Phänomen. Und seit jeher gilt, dass der Mensch nicht
aus einem Stück ist, sondern eine Summe von Widersprüchen (Dragan
Velikic [21]).
Gegen die Kälte des Todes ist
die Kühle der reinen Autonomie eine schwache, manchmal untaugliche
Hilfe. Dann kann milder Paternalismus ein letztes wärmendes Feuer
sein.
Modelle der Arzt-Patient-Beziehung
Die Bioethiker Linda und Ezekiel Emanuel
[22  ],
haben sich, ausgehend von der Vorstellung, dass die Überwindung des
Paternalismus zu einer sehr nüchternen und nur begrenzt tauglichen
Form von Patientenautonomie führen könnte, mit nicht-paternalistischen
Modellen der Arzt-Patient-Beziehung beschäftigt. Dem klassischen paternalistischen
Modell stellen sie drei Modelle gegenüber, die dem Patienten Autonomie
einräumen, aber auch dem Arzt eine aktive Rolle in der Beratung und
Klärung, beispielsweise von Wertvorstellungen, ermöglichen: ],
haben sich, ausgehend von der Vorstellung, dass die Überwindung des
Paternalismus zu einer sehr nüchternen und nur begrenzt tauglichen
Form von Patientenautonomie führen könnte, mit nicht-paternalistischen
Modellen der Arzt-Patient-Beziehung beschäftigt. Dem klassischen paternalistischen
Modell stellen sie drei Modelle gegenüber, die dem Patienten Autonomie
einräumen, aber auch dem Arzt eine aktive Rolle in der Beratung und
Klärung, beispielsweise von Wertvorstellungen, ermöglichen:
Modelle der Arzt-Patienten-Beziehung
[23]
(nach Ezekiel J. Emanuel / Linda L.
Emanuel)
-
"paternalistisches Modell": auch
Eltern- oder Priestermodell, der Arzt weiß, was das Beste für
den Patienten ist
-
"informatives Modell": auch technisches
oder Konsumentenmodell: Ärzte als technische Experten, die den Patienten
fachliche Informationen als Entscheidungsgrundlage bieten
-
"interpretatives Modell": der Arzt
als Berater und Begleiter des Patienten, der Informationen liefert, bei
der Klärung von Wertvorstellungen hilft und Maßnahmen vorschlägt
(der Arzt sucht das Gespräch über die Werthaltungen der Patienten)
-
"deliberatives Modell": der Arzt
als Lehrer und Freund, der sich mit dem Patienten über die besten
Handlungsmöglichkeiten unterhält (der Arzt sucht das Gespräch
über mögliche Inhalte von Werthaltungen)
|
|
Dabei wird deutlich, dass sich der
kommunikative Anspruch dieser drei Modelle vom informativen, über
das interpretative zum deliberativen Model deutlich ändert. Während
beim informativen Modell die fachliche Information des Patienten im Zentrum
steht, beruht das deliberative Modell in einem Gespräch zwischen Arzt
und Patient, in dem es nicht nur um die besten Handlungsmöglichkeiten
sondern auch Werthaltungen geht. Der Arzt übernimmt dabei die Rolle
des Lehrers und Freundes.
Welches der nicht-paternalistischen
Modelle bei der Betreuung von Patienten am Ende ihres Lebens das angemessene
ist, kann nur individuell herausgefunden werden und sich im Krankheitsverlauf
ändern.
Das interpretative Modell dürfte
in vielen Situationen Vorteile bieten. Der Arzt liefert nicht nur Informationen,
sondern hilft dem Patienten bei der Klärung und Deutung seiner Wünsche
und Einstellungen. Dieser Prozess kann aber nur dann Aussicht auf Erfolg
haben, wenn der Arzt sich auf seinen Patienten einlässt, wenn er bereit
ist, die Selbstauslegung der Krankheit durch den Patienten auf- und ernst
zu nehmen.
Gestützte Autonomie
Ein vereinheitlichendes Modell möchte
ich mein Konzept der "gestützten Autonomie" nennen. Auch hier steht
die Selbstbestimmung des Patienten ganz im Mittelpunkt.
Das Modell trägt aber auch der
Tatsache Rechnung, dass manchem Schwerstkranken nicht mehr genügend
Energie zur Verfügung steht, seine Autonomie überhaupt wahrzunehmen
und seine Entscheidungen an ihr auszurichten.
In einem ersten Schritt nimmt der Arzt
die Rolle des "Ermöglichers", wie Viktor von Weizsäcker [24]
es genannt hat, wahr. Diese Rolle kann vieles umfassen. Beispielsweise
zunächst eine sorgfältige und individuell angepasste Behandlung
somatischer Beschwerden, um überhaupt die physische Basis zu schaffen,
in der Entscheidungsfähigkeit möglich ist.
Die Ermöglicher-Rolle beinhaltet
auch, ein Bewusstsein des Anspruchs auf Selbstbestimmung wieder freizulegen,
das vielleicht unter massiven diagnostischen und therapeutischen Eingriffen
verschüttet gewesen ist. In einem weiteren Schritt folgt das ärztliche
Angebot der Präsenz als Begleiter und schließlich Berater, von
dem der Kranke nach seinen Vorstellungen und Wünschen Gebrauch machen
kann. Erst dann ist möglicherweise das Feld für eine Arzt-Patient-Beziehung
bereitet, in dem die Selbstauslegung der Krankheit durch den Patienten
möglich wird, eine narrative Aufarbeitung der Lebens- und Leidensgeschichte,
die im Idealfall zu einer Neuorientierung führt.
Mit anderen Worten, "gestützte
Autonomie" bedeutet: die Wahrnehmung der Autonomie des Patienten kann in
gewissen Situationen erst durch die stützende Funktion des Arztes
möglich werden.
Der fragmentierte Patient
Die konventionelle Gesprächsführung
in der Medizin ist nicht auf eine ganzheitliche Beschwerdenerfassung ausgerichtet.
Vielmehr zerlegt sie die Patientenäußerungen in Einzelbeschwerden
und blendet damit das Selbstbild des Kranken, die von ihm erlebten Bedeutungen,
Zusammenhänge und Befindlichkeiten aus. Die Wahrnehmung des Kranken
erfolgt dann nur noch in unzusammenhängenden Teilaspekten. Das Bild,
das sich daraus ergibt, ist treffend mit dem Begriff des fragmentierten
Patienten beschrieben worden (Johanna Lalouschek [25  ],
Walter Böker [26 ],
Walter Böker [26  ]). ]).
Die Konsequenz ist, dass diese Art
von kommunikativer Vivisektion kein Bild eines Kranken aus Fleisch und
Blut entstehen lässt. Vielmehr setzt sie nicht selten erneute Wellen
diagnostischer und auch fragwürdiger therapeutischer Aktionen in Gang.
Die konsekutiv wachsenden Datenanhäufungen erweisen sich am Ende oft
nur als Datenfriedhöfe. So kann sich die absurde Situation ergeben,
dass in den letzten Lebenstagen eines Achtzigjährigen mehr Daten akkumuliert
werden, als in den gesamten vorangegangenen achtzig Jahren. Die Lebens-
und Leidengeschichte des Kranken enthalten sie nicht.
Doch genau um diese Geschichten geht
es. Der Philosoph Odo Marquard schreibt: "Denn die Menschen: das sind ihre
Geschichten. Geschichten aber muss man erzählen ... und je mehr versachlicht
wird, desto mehr - kompensatorisch - muss erzählt werden: sonst sterben
die Menschen an narrativer Atrophie" [27].
Ein interessanter narrativer Ansatz
stammt von Arthur W. Frank [28]. Er verwendet die Metapher des "verwundeten
Geschichtenerzählers". Sie deckt auf, dass Patienten mehr sind als
nur Opfer einer Krankheit. Indem sie ihre Krankheiten als Geschichten erzählen,
eröffnet sich ihnen die Chance einer neuen Orientierung nachdem vielleicht
ihre bisherige Welt zusammengebrochen ist. Auf diese Weise wird der Kranke
selbst zum Heiler. Die Geschichten der Patienten sind mehr als Berichte
über ihr persönliches Leiden, sie beinhalten auch die Chance,
moralische Einsichten zu entwickeln. Früher oder später, schreibt
Frank, der selbst an Krebs erkrankt war, wird jeder zum "wounded storyteller",
zum verwundeten Geschichtenerzähler.
Der erste meiner Patienten, den ich
als "verwundeten Geschichtenerzähler" erlebt habe, war selbst Arzt.
Es war auch der erste Patient, dessen Sterben ich überhaupt über
eine Weile mitverfolgen konnte. Freilich wusste ich damals noch nichts
vom "wounded storyteller" und den möglichen Wirkungen von Narration.
Ich glaube, dass ich erst heute, nach mehr als vierzig Jahren - vielleicht
- zu verstehen beginne, was damals geschehen ist.
Der Patient war Anfang vierzig, hatte
Jahre als Hausarzt praktiziert, war schwer morphinsüchtig, mit einem
chaotischen Leben und mehreren Ehen hinter sich. Seine Approbation als
Arzt war ihm längst entzogen worden.
An einem Sommermorgen war er, vollgepumpt
mit Morphin vom Dach eines zweistöckigen Hauses gesprungen, um, wie
er dabei ausrief "gegen die lächerlichen Gesetze der Schwerkraft"
zu protestieren. Mit gebrochenen Beinen wurde er in das Krankenhaus eingewiesen,
in dem ich als ganz junger Arzt zu arbeiten begonnen hatte. Wegen dieses
gescheiterten Versuchs zu fliegen, nannte ich den Patienten später
für mich einfach Ikarus. Entsprechend den damaligen Vorstellungen
von Drogenabhängigkeit als schuldhaftem Versagen wurde er wie der
letzte Underdog der Klinik behandelt oder besser gesagt, nicht behandelt.
Sein Bruder, ein erfolgreicher Internist und Chef des Krankenhauses ließ
sich so gut wie nicht blicken. Mich, als den Jüngsten im Team, ordnete
man ab, um mich "irgendwie" um Ikarus zu kümmern.
Ikarus überwand seine Entzugserscheinungen
überraschend schnell, saß halb aufgerichtet, braungebrannt,
mit dichten schwarzen Haaren, rauchend und mit eingegipsten Beinen im Bett.
Er strahlte die Gesundheit eines kalifornischen Wasserskilehrers aus. Ich
versuchte mich um diese Aufgabe, die mich völlig überforderte,
möglichst zu drücken, wurde aber immer mehr von den Geschichten
in Bann geschlagen, die Ikarus mir täglich erzählte. Es entwickelte
sich ein Ritual, das darin bestand, dass ich Tag für Tag, oft länger
als eine Stunde, an seinem Bett saß, ohne mich von seinen Erzählungen
lösen zu können. Er erzählte nichts aus seinem Leben, sondern
führte mir die alltäglichen oder dramatischen, die scheinbar
unbedeutenden oder tragischen Geschichten seiner Kranken mit einer Plastizität
vor Augen, die mich nicht mehr losließ. Mir begann zu dämmern,
dass ich eine Abfolge von Lehrstücken erleben konnte, die von einer
faszinierenden Einsichtsfähigkeit in die Welt seiner Kranken sprachen.
Ikarus musste schlicht und einfach ein brillanter Arzt gewesen sein. Natürlich
hatte er einen ständig wachsenden Zulauf, der ihn zunächst zur
Hochform trieb, dann aber in eine immer stärkere Überforderung
und Erschöpfung, in der er sich anfänglich nur ab und zu, später
aber regelmäßig mit Morphin kurze Erholungsphasen zu verschaffen
suchte. Ich nahm also als einziger Schüler an einem großartigen
Seminar über ärztliche Grundhaltungen teil. Ikarus war mein erster
wirklicher Lehrer geworden. Er selbst genoss diese Rolle mehr und mehr
und lebte in ihr sichtlich auf.
An einem Morgen schlug er die Bettdecke
zurück, deutete auf seine Beine und sagte: "Heute bin ich selbst der
Fall, den ich Ihnen vorstellen will." Um es kurz zu machen, er demonstrierte
mir, dass seine Beine nicht nur gebrochen, sondern bis über die Knie
gelähmt waren, und wie die nächsten Tage zeigten, dass diese
Lähmung unaufhaltsam von unten nach oben seinen Körper zu ergreifen
begann. Er zeigte das klassische Bild einer sog. Landry-Paralyse, einer
akuten aufsteigenden Rückenmarkslähmung, die zum Schluss die
Atemzentren des Gehirns erreicht und durch Atemlähmung zum Tode führt.
Mit wissenschaftlicher Akribie beschrieb er an sich selbst dieses seltene
Krankheitsbild, den klinischen Verlauf und den zu erwartenden tödlichen
Ausgang.
Die einzige Behandlung, die hätte
eingesetzt werden können, die künstliche maschinelle Beatmung,
stand damals nur in Universitätskliniken zu Verfügung. Wenige
Tage später, an einem Samstagmorgen eines sonnigen Julitages hatte
die Lähmung bereits begonnen, seine Atemmuskeln zu erfassen. Ich hatte
an dem bevorstehenden Wochenende dienstfrei. Ikarus lag, nun schwerer atmend
als sonst, halb aufgerichtet, aber ausgesprochen heiter in seinem Bett,
die ewige Zigarette im Mund. Er wusste, dass er allenfalls noch einen Tag
zu leben hatte, und ich wusste es inzwischen durch ihn, ebenfalls.
Das einzige, was ihn zu interessieren
schien, war ich, sein Schüler. "Was werden Sie an diesem Wochenende
machen, Kollege?" fragte er. Ich brachte es kaum heraus: "Ich werde schwimmen
gehen, im Waldsee." Ich setze hinzu: "Aber ich werde lieber auch morgen
hierher kommen." Er schüttelte den Kopf und sagte." Nein, nein. Diesen
Sonntag brauche ich für mich." Dann fügte er, fast besorgt hinzu:
"Geben Sie acht auf sich! Im Waldsee gibt es einige tückische Stellen.
Da sind schon ein paar Leute ertrunken." Und nach einer kurzen Pause: "Es
wäre mir gar nicht recht, wenn Sie vor mir drüben einträfen."
Als ich am Montag früh in sein
Zimmer kam, lag dort schon ein anderer Patient, ein Studienrat, der sich
über das Frühstück beschwerte.
Indem er die Geschichten seiner Patienten
erzählte, erzählte Ikarus sein Leben. Als buchstäblich verwundeter
Erzähler hatte er sich sozusagen selbst im weitesten Sinne geheilt
und konnte seinen Tod friedlich sterben. Nicht als chaotischer Drogensüchtiger,
sondern in dem Bewusstsein, dass sein Leben für viele andere sehr
sinnvoll gewesen war.
Damals lernte ich auch, dass es nicht
immer leicht zu entscheiden ist, wer Arzt und wer der Patient ist.
Auf den ganzen Komplex des "Story Telling"
und der narrativen Ethik kann hier nicht weiter eingegangen werden (z.B.
David H. Smith [29]). Das Phänomen des "verwundeten Heilers" reicht
bis in die Mythen der Antike zurück. Der verwundete Heiler, weiß
um seine Verletzlichkeit, was ihn zu einer vertieften Empathie befähigt.
Am bekanntesten ist die Geschichte von Chiron, des durch einen vergifteten
Pfeil verwundeten Arztes [30].
Der unbewaffnete Arzt
Was aber bleibt dem Arzt am Ende, angesichts
des schwerstkranken oder sterbenden Patienten, wenn es schließlich
nichts mehr zu messen, nichts mehr zu operieren, nichts mehr zu spritzen
gibt? Wenn sich keiner mehr hinter babylonisch aufgetürmten Apparaturen
verbergen kann?
Das ist dann die Stunde der Instrumentenlosigkeit
[31]. Die Stunde des unbewaffneten Arztes. Des Arztes, der seine
eigenen Ängste kennen gelernt hat und seine eigene Sterblichkeit nicht
verdrängt. Dieser Arzt ohne Waffen ist ein starker und zugleich einfühlsamer
Arzt. Er erlebt das Sterben des Kranken nicht als Versagen. Er ist der
Arzt, den sein Patient gerade jetzt dringend benötigt.
Bei dem letzten Patienten, dessen Geschichte
ich Ihnen erzählen möchte, befanden wir uns an der Schwelle zur
Instrumentenlosigkeit. Der 59jährige Patient litt an einer besonders
bösartigen Form von Lymphknotenkrebs (hochmalignes Non-Hodgkin-Lymphom).
Zunächst war es gelungen durch Bestrahlung und Chemotherapie eine
weitgehende Rückbildung der Krankheit zu erreichen, wobei der Patient
eine bewundernswerte Kooperation an den Tag legte. Dann aber war es rasch
zu einem ausgedehnten Rückfall gekommen, der auf die übliche
Therapie nicht mehr ansprach. Der Patient war ein stiller, verschlossener,
in sich gekehrt wirkender Mann, der allen bisherigen Behandlungsvorschlägen
ohne größere Rückfragen zugestimmt hatte. Als letzte Behandlungsmöglichkeit
kam allenfalls eine sogenannte aggressive Maximaltherapie in Frage, mit
nur sehr geringen Aussichten auf eine auch nur vorübergehende Besserung.
Ich war mir außerordentlich unsicher, wie wir uns verhalten sollten.
Ich ahnte, dass der Patient, welche Alternative wir ihm auch vorschlagen
würden (Maximaltherapie oder palliative Behandlung), jedem Vorschlag
zustimmen würde. Ich sah mich mit meinem Team nicht imstande, seinen
wirklichen Standort auszumachen.
In diesem Dilemma versuchte ich einen
anderen Weg einzuschlagen. Ich brachte ihm einen Zeichenblock und Buntstifte
und bat ihn, einfach aufzuzeichnen wie er sich fühlte, was in ihm
vorging. Er zögerte zunächst. Aber am nächsten Tag schob
er mir bei der Visite diese Zeichnung zu:
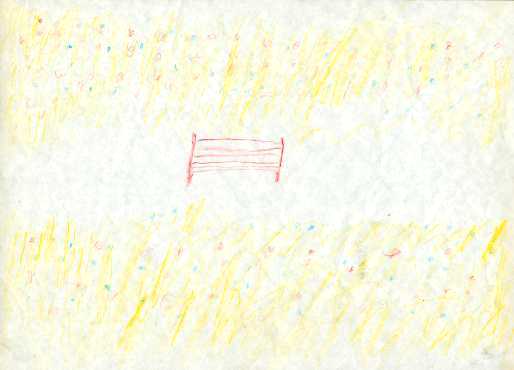 Als wir ihn um eine Deutung
baten, sagte er: "Das ist ein blühendes Kornfeld mit vielen Blumen."
Als wir ihn um eine Deutung
baten, sagte er: "Das ist ein blühendes Kornfeld mit vielen Blumen."
Wer sich etwas mit Bildsymbolik
beschäftigt hat weiß, dass ein Kornfeld Fruchtbarkeit und Erfolg
in jeder Hinsicht versinnbildlicht, und dass Blumen für das Werden
und Vergehen des Lebens stehen.
Auf die Frage, was er in
die Mitte des Bildes gezeichnet habe, antwortete er: "Das sieht man doch!
Das ist die Bank, auf der ich mich endlich ausruhen möchte."
Drei Tage später starb
der Patient ganz ruhig und friedlich.
Die Einsamkeit der Sterbenden
In seinem Buch Über
die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen schreibt Norbert Elias
[32]: "Was Menschen tun können, um Menschen ein leichtes und friedliches
Sterben zu ermöglichen, bleibt noch herauszufinden."
Es bleibt jedes Mal und immer
wieder neu herauszufinden, wenn gilt, dass jeder Mensch seinen eigenen
Tod sterben will. Nicht den Tod anderer, d.h. auch nicht den Tod der
Ärzte. Es gelingt immer nur annäherungsweise - mehr oder minder.
Dabei gibt es Glücksfälle; dann ist es berechtigt, von einem
glücklichen
Tod zu sprechen. Nicht immer ist dieses Ideal zu erreichen. Wenn wir
ehrlich sind, dann eher selten.
Die Einsamkeit und das Ohnmachtgefühl
im Sterben lassen sich nicht bewältigen durch ein Verständnis
von Autonomie, das nicht mehr ist, als ein Widerstandsbegriff gegen jede
Art von Bevormundung [33]. Sie kann Einsamkeit noch verstärken. Sie
geht von einer illusorischen Symmetrie der Arzt-Patient-Beziehung aus.
Fraglich ist, ob eine Symmetrie von Patientenseite überhaupt durchgängig
erwünscht ist [34]. Nicht zwei Gleiche stehen sich gegenüber,
sondern ein hilfesuchender Mensch und einer, der kompetent ist, diese Hilfe
zu geben.
Gestützte Autonomie
dürfte den weitesten Spielraum für den Wunsch nach Selbstbestimmung
im Sterben umfassen. Dies kann sogar auch bedeuten, dass das Prinzip der
Fürsorge bei weitem überwiegt.
Am Ende geht es jenseits
bindender Modelle darum, dass der Sterbende gewiss sein kann, eine letzte
Obhut zu finden.
Literatur:
[1] Frisch, M.: Tagebuch
1966-1971. Suhrkamp. Frankfurt/Main. 1972
[2] Kampits, P.: Das dialogische
Prinzip in der Arzt-Patienten-Beziehung. Passau. 1996
[3] Zimmermann-Acklin, M.:
Zur Sterbehilfediskussion in der theologischen Ethik. Ethik Med (2000)
12:2-15
[4] Sill, Bernhard: Gedanken
zu einer neuen "ars (bene) moriendi" in der Dichtung Rainer Maria Rilkes.
Renovatio - Zeitschrift für das interdisziplinäre Gespräch.
Heft 3. 49. Jahrgang. September 1993. S. 140-151
[5] Elias, N.: Über
die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen. Frankfurt/Main. 1982. S.
100
[6] Rilke, R.M.: Die Aufzeichnungen
des Malte Laurids Brigge. Insel Verlag. Frankfurt a.M. 1966. S. 712-724
("Jetzt wird in 559 Betten gestorben. Natürlich fabrikmäßig.
Bei einer so enormen Produktion ist der einzelne Tod nicht so gut ausgeführt,
aber darauf kommt es auch nicht an. Die Masse macht es. Wer giebt heute
noch etwas für einen gut ausgearbeiteten Tod?")
[7] Smith, R.: A good death.
BMJ Volume 320, 15. Januar 2000. S. 129-130. -
URL: http://bmj.com/cgi/content/full/320/7228/129 
[8] Principles of a good
death:
- To know when death is
coming, and to understand what can be expected
- To be able to retain control
of what happens
- To be afforded dignity
and privacy
- To have control over pain
relief and other symptom control
- To have choice and control
over where death occurs (at home or elsewhere)
- To have access to information
and expertise of whatever kind is necessary
- To have access to any
spiritual or emotional support required
- To have access to hospice
care in any location, not only in hospital
- To have control over who
is present and who shares the end
- To be able to issue advance
directives which ensure wishes are respected
- To have time to say goodbye,
and control over other aspects of timing
- To be able to leave when
it is time to go, and not to have life prolonged pointlessly
[9] Muschg, A.: Geschichte
eines Manuskripts. Vorwort in: Zorn, F.: Mars. Frankfurt/Main 1979.
[10] Bappert, L.: Der Knoten.
Vertrauen und Verantwortung im Arzt-Patienten-Verhältnis am Beispiel
Brustkrebs. Rowohlt. 1979
[11] Wander, M.: Leben wär'
eine prima Alternative. Hrsg. Fred Wander. Darmstadt & Neuwied. Luchterhand.
1980
[12] Geisler, L.S.: Muss
der Arzt alles tun, was möglich ist? Vortrag. Hamburg. 1996
[13] Kübler-Ross, E.:
Interviews mit Sterbenden. Gütersloher Verlagshaus. 17. Auflage. 1996
[14] Kübler-Ross, E.:
aaO. [13]
[15] Siegmund-Schultze, N.:
Wie viel Aufklärung am Krankenbett ist moralisch vertretbar? Ärzte
Zeitung, 22.10.1997.
URL: http://www.aerztezeitung.de/docs/1997/10/22/190a0301.asp 
[16] Gross, Peter: Ich-Jagd.
Suhrkamp. Frankfurt/Main 1999.
[17] Stout, J.: Ethics After
Babel: The Languages of Morals and Their Discontents. Boston, Beacon. 1988.
(Moral Esperanto: "an artificial moral language invented in the (unrealistic)
hope that everyone will want to speak it.")
[18] Geisler, Linus: Arzt-Patient-Beziehung
im Wandel - Stärkung des dialogischen Prinzips. Beitrag im Abschlussbericht
der Enquete-Kommission "Recht und Ethik der modernen Medizin" vom 14.05.2002,
S. 216-220 -
URL: http://www.linus-geisler.de/art2002/0514enquete-dialogisches.html 
[19] Schotsmans, P.T.: Der
Mensch als Schöpfer. In: Herbert Quandt-Stiftung (Hrsg.) Wem gehört
der Mensch? 17. Sinclair-Haus Gespräch. Bad Homburg v.d. Höhe.
2002
[20] Poppe-Teufel, I.: Tollkirschenzeit.
Malignes Melanom als Erfahrung an der Lebensgrenze. Frankfurt/Main 1991.
[21] Velikic, D.: Ein Mensch
wie eine Insel - Erinnerungen an Aleksandar Tima. F.A.Z., 20. Februar
2003. S. 40
[22] Emanuel E.J., Emanuel,
L.L.: Four Models of the Physician-Patient Relationship. JAMA 267:2221-6,
1992
Übersicht z.B. unter
URL: http://www.msu.edu/course/hm/546/ft1-4.htm 
[23] Zimmermann-Acklin, M.:
Selbstbestimmung in Grenzsituationen. Vom Protest gegen den ärztlichen
Paternalismus zur Wiederentdeckung von Beziehungsgeschichten. 4. Fachtagung
in der Reihe "Gesundheit in eigener Verantwortung?". Deutsches Hygiene-Museum
in Partnerschaft mit der DKV Krankenversicherung AG. 28./29. September
2001 -
URL:
http://www.dhmd.de/forum-wissenschaft/fachtagung04/ft04-z-acklin_ref.htm
- [Broken Link/Link zerbrochen]
[24] v. Weizsäcker,
V.: Körpergeschehen und Neurose. Stuttgart. 1985.
[25] Lalouschek, J.: Ärztliche
Gesprächsausbildung. Radolfzell. 2002 -
URL: http://www.verlag-gespraechsforschung.de/lalouschek.htm 
[26] Böker, W.: Arzt-Patient-Beziehung:
Der fragmentierte Patient. Deutsches Ärzteblatt 100, Ausgabe 1-2 vom
06.01.2003, Seite A-24 -
URL: http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikeldruck.asp?id=35041 
[27] zit. n. Schernus, R.:
Abschied von der Kunst des Indirekten - oder: Umwege werden nicht bezahlt.
In: J. Blume et al (Hr.): Ökonomie ohne Menschen? Neumünster.
Paranus. 1997.
[28] Frank, A.: The wounded
storyteller. Body, Illness and Ethics. University of Chicago Press. 1995
[29] Smith, D H.: Telling
Stories as a Way of Doing Ethics. Connecticut Medicine, Bd. 51, Nr. 11,
1987, S. 725-31.
[30] Reinhart, M.: Chiron
- Heiler und Botschafter des Kosmos. Edition Astrodata, CH-8907 Wettswil.1993.
[31] Schara, J.: Patientenführung
bei Krebsschmerz. In: Baar H.A.: Schmerzbehandlung in Praxis und Klinik.
Springer, Berlin 1987, 114-127
[32] Elias, N.: aaO. [5]
[33] Zimmermann-Acklin, M.:
aaO. [23]
[34] Eibach, U., Schaefer,
K.: Patientenautonomie und Patientenwünsche. Ergebnisse und ethische
Reflexion von Patientenbefragungen zur selbstbestimmten Behandlung in Krisensituationen.
Medizinrecht, 1, S. 21-28. 2001
|
|
| Geisler, Linus S.: Jeder Mensch stirbt
anders - Arzt-Patient-Kommunikation am Lebensende. Vortrag anlässlich
des 4. Friedrichshainer Gesprächs, veranstaltet vom Institut Mensch,
Ethik und Wissenschaft (IMEW) am 2. April 2003 in Berlin. |
| URL dieses Vortrags: http://www.linus-geisler.de/vortraege/030402lebensende.html |
|