| Wenn die Sprache nicht
stimmt, |
| dann ist das, was gesagt
wird, |
| nicht das, was gemeint
ist. |
|
Konfuzius
|
Haben Sie die Aussage verstanden? Wahrscheinlich
nicht. Sie lässt sich aber ohne weiteres in eine Sprache kleiden,
die jeder verstehen kann: "Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese
drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen." (1. Korintherbrief
13,13). Diese Formulierung enthält alle sprachlichen Elemente, die
dem Verständnis dienen, denn diese Sprache ist:
-
einfach,
-
kurz,
-
anschaulich,
-
geordnet,
-
verwendet bekannte Worte.
Im übrigen ist die Bibel, insbesondere das Neue
Testament, ein exzellenter Lehrtext für klare, verständliche
und überzeugende Sprache.
Verständlichkeit
Verständlichkeit ist die Voraussetzung des erfolgreichen
Gesprächs zwischen Arzt und Patient. Der Arzt denkt, lebt und bewegt
sich in einer eigenen Sprache, die zudem Ausdruck seiner "Wirklichkeit"
ist. Darin liegt eine Quelle zahlreicher kommunikativer Störungen,
vom einfachen Missverständnis bis zum völligen Nichtverstehen
und Nichtverstandenwerden. Das Problem wird noch dadurch verstärkt,
dass sich der Arzt häufig im guten Glauben befindet, von seinem Patienten
verstanden worden zu sein. Spätere kritische Äußerungen
des Kranken, wie "Darüber hat der Arzt mit mir nicht geredet ...",
"Ich weiß eigentlich gar nicht, was der Arzt gewollt hat ...", sind
für den Arzt dann völlig überraschend. Eine der entscheidenden
Kontrollfragen beim sogenannten unbefriedigenden Gespräch muss daher
für den Arzt lauten: Habe ich eine Sprache benutzt, in der mich mein
Patient überhaupt verstehen konnte?
Verständliches Sprechen ist sowohl eine
Frage der Sachinhalte als auch des Sprachstils. SCHULZ VON THUN unterscheidet
4 "Verständlichmacher" beim Sprechen:
-
Einfachheit,
-
Gliederung und Ordnung,
-
Kürze und Prägnanz,
-
zusätzliche Anregung (Stimuli).
Was bedeutet dies im einzelnen?
Einfachheit:
Die einfache Sprache verwendet kurze Sätze
und bekannte Wörter. Wo Fachwörter unvermeidbar sind,
müssen sie erklärt werden. Anschauliches Sprechen erhöht
die Verständlichkeit. Wenn der Arzt mit seinem Patienten wie ein "normaler
Mensch" redet, wird er besser verstanden werden und besser motivieren können,
als wenn er sich einer "Gelehrtensprache" bedient.
Einfach zu sprechen ist ebenso schwierig wie einfach
zu schreiben. Großartige Reden oder "Fachchinesisch" gehen leichter
über die Lippen. Der großartige Stil ist aber voller Schlupfwinkel.
Damit eröffnet er Möglichkeiten, in einer unbestimmten Distanz
zum Gesprächspartner zu bleiben und sich nicht wirklich auf ein Gespräch
einzulassen Nur eindeutige Sachverhalte lassen sich in einfacher
Sprache ausdrücken. Verquastes Reden ist daher häufig auch ein
Indiz für nebulöse Denkinhalte. Schließlich dient Einfachheit
nicht nur dem besseren Verständnis, sondern die einfache Sprache wirkt
auch echt und damit vertrauengewinnend.
Gliederung und Ordnung:
Diesem Gebot gehorcht eine Sprache, die äußerlich
übersichtlich und innerlich folgerichtig ist. Ludwig REINERS
sagt: "Der Mensch kann nicht zwei Gedanken auf einmal aussprechen, also
muss er sie hintereinander anordnen." Und was SCHOPENHAUER über das
Schreiben ausführt, gilt ebenso für das Sprechen: "Wenige schreiben,
wie ein Architekt baut, der zuvor einen Plan entworfen und bis ins Einzelne
durchdacht hat; vielmehr die meisten nur so, wie man Domino spielt."
Typisch dafür ist das sogenannte assoziative
Reden: Die Satzfolge wird nicht von gedanklichen Zusammenhängen bestimmt,
sondern von assoziativ produzierten Einfällen. Der Hang zum assoziativen
Reden ist keinesfalls eine seltene sprachliche Unart, sondern die Neigung
fast aller Menschen. Assoziatives Sprechen führt zu langatmigen Ausführungen,
die frühzeitig ein Abschalten des Gesprächspartners bewirken.
Kürze und Prägnanz:
Kürze bedeutet sowohl sprachliche als
auch sachliche Kürze. Sich kurz auszudrücken, bereitet
den meisten Menschen Schwierigkeiten und ist ohne Übung und Sprachdisziplin
kaum zu erreichen. Selbst GOETHE schrieb an seine 18jährige Schwester:
"Da ich keine Zeit habe, Dir einen kurzen Brief zu schreiben, schreibe
ich Dir einen langen ...".
Das Extrem sprachlicher Knappheit ist das Telegramm,
das Extrem sachlicher Kürze der Aphorismus. Natürlich eignen
sich beide Extreme nicht für das Gespräch zwischen Arzt und Patient:
Der Telegrammstil wirkt unpersönlich und vernachlässigt die kontaktive
Funktion der Sprache, der Aphorismus kann durch die Dichte der Aussage
zur Überforderung führen.
| Die Forderung muss daher lauten: Sätze von
überschaubarer Länge und einem Informationsgehalt, der der Auffassungsgabe
und dem Aufnahmevermögen des Patienten entspricht. |
|
Kürze bedeutet auch, dass die Satzfolgen nicht
zu umfangreich werden. Untersuchungen haben ergeben, dass der nichttrainierte
Zuhörer sich an den Inhalt von Satzfolgen, die länger als 40
Sekunden dauern, nicht erschöpfend erinnern kann. Kürze bedeutet
daher auch, viele Informationen mit wenigen Worten zu geben,
aber nicht zu viele Informationen nacheinander.
Kürze darf jedoch nicht auf Kosten der nicht
sachbezogenen Botschaften des Sprechens gehen, d.h. die kontaktiven und
selbstdarstellenden Anteile auf Null absinken lassen. Der Telegrammstil
ist zwar vom Informationsgehalt hochkonzentriert, unter informationstheoretischen
Aspekten nicht optimal.
Redundanzen sind informationstheoretisch weglassbare
Elemente einer Nachricht, weil sie keine zusätzliche Information liefern.
Dennoch sind sie notwendig, weil sie zur Stützung und Sicherung der
Grundinformationen beitragen. Da höchstens ein Drittel des einmal
Gesagten erinnert werden kann, sind Redundanzen beim Sprechen in einem
gewissen Umfang unerlässlich.
Zusätzliche Anregungen (Stimuli):
Sprachliche Bilder und Vergleiche unterstützen
wesentlich die Anschaulichkeit des Gesagten. Sie sind ein wichtiges rhetorisches
Stimulans und sozusagen das Salz in der Suppe der Information. So sagt
GOETHE: "Gleichnisse dürft Ihr mir nicht verwehren, ich wüsste
mich sonst nicht zu erklären".
Das sprachliche Bild
Die meisten Menschen sind Augenmenschen. Daher ist die
Umgangssprache voller Bilder, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst
sind: "Ich möchte Ihnen reinen Wein einschenken ...", "Die Idee wurde
mit offenen Armen aufgenommen".
Das Sprechen in Bildern und Vergleichen ist eine
wirkungsvolle Methode, sich durch Anschaulichkeit besser verständlich
zu machen. Die Sprache der Medizin steckt voller abstrakter Begriffe. Gerade
deshalb bietet sich im Gespräch zwischen Arzt und Patient die Verwendung
von Bildern und Vergleichen als "Verständlichmacher" an.
Die Evangelien des Neuen Testaments (in der LUTHER-Übersetzung)
sind eine Fundgrube für die Wirkungskraft von sprachlichen Bildern
und Gleichnissen. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf lässt sich sprachlich
kaum prägnanter als bei Matthäus darstellen (Matthäus 18,12-14):
"Was meint Ihr? Wenn irgendein Mensch 100 Schafe hätte und eins unter
ihnen sich verirrte: Lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin
und sucht das verirrte?"
Diese Textstelle ist im übrigen auch ein gutes
Beispiel dafür, dass die in eine Frage gekleidete Aussage ein wirksames
Instrument der Überzeugung ist. Von Jesus heißt es im Neuen
Testament: "... und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen ..." Und bereits
in den Psalmen steht: "Ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und
will aussprechen, was verborgen war ..." (Psalm 78,2).
Die Verwendung sprachlicher Bilder und Vergleiche
lässt sich nur begrenzt lehren. Es gibt jedoch zwei Möglichkeiten,
dem eigenen Sprachstil im Umgang mit Patienten mehr Anschaulichkeit zu
verleihen:
-
Prüfen Sie systematisch, ob abstrakte Begriffe
nicht besser durch ein Bild oder ein Vergleich aus der Alltagssprache
ersetzt werden können.
-
Prüfen Sie, welche der von Ihnen verwendeten
Bilder und Vergleiche sich als erfolgreich erwiesen haben, und verwenden
Sie sie häufiger im Gespräch mit Ihren Patienten.
Dazu ein Beispiel aus dem klinischen Alltag:
Bei Erkrankungen ohne subjektive Beschwerden fällt
es bekanntlich besonders schwer, Patienten von der Notwendigkeit einer
Therapie zu überzeugen. Die häufigsten Gegenargumente lauten:
"Ich spüre ja nichts ..." oder "Bisher ist alles gutgegangen ..."
Hier lässt sich mit folgendem Vergleich argumentieren: "Was Sie sagen,
erinnert mich an den Mann, der vom Dach eines Hochhauses fällt und
im Sturz den Leuten im 1. Stock zuruft: ,Ich weiß gar nicht, warum
die Menschen sich fürchten, abzustürzen. Bis jetzt ist alles
prima gegangen!‘"
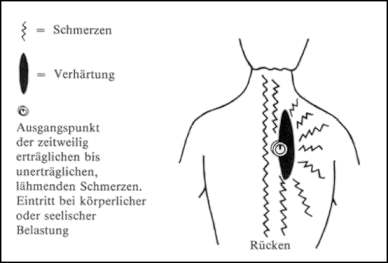 |
Neben dem sprachlichen Bild, Beispielen,
Vergleichen und sparsam verwendeten Zitaten zählen
Skizzen, Schaubilder
oder Piktogramme zu den weiteren Stimuli, die in der Lage sind,
die Verständlichkeit zu erhöhen. Sie stellen Gesprächshilfen
dar, sollten also nicht zum Gesprächsersatz werden und bedürfen
immer der Erläuterung. Wahrscheinlich nutzen Ärzte die Möglichkeit
zu selten, dass auch der Patient sich dem Arzt durch eine Zeichnung oder
eine Skizze besser verständlich machen kann. Einer meiner Patienten
mit schwerer Belastungs-Angina-pectoris konnte seine überwiegend in
den Rücken ausstrahlenden Schmerzen am besten anhand einer Skizze
verdeutlichen.
Der hohe Symbolgehalt, den von Patienten gezeichnete
Bilder besitzen, vermitteln manchmal in überaus beeindruckender
Weise Bilder von Krebspatienten. Tumorpatienten haben nicht selten große
Schwierigkeiten, ihre wirklichen Empfindungen sowie ihre Auffassung und
ihr Verständnis von ihrer Krankheit und die Beziehung zu ihr zu verbalisieren. |
Noch so einfache und unkünstlerisch wirkende
Zeichnungen und Bilder ermöglichen manchmal überwältigende
Einblicke in die Gefühls- und Erlebniswelt des Kranken, die er sprachlich
nicht annähernd so deutlich darzustellen vermag (siehe auch Kapitel
"Gespräche mit Todkranken und Sterbenden"  ). ).
Sprachstil
Der Sprachstil muss die Individualität des Patienten
berücksichtigen: Alter und Geschlecht, Beruf, Bildungsniveau, sozialen
Status, Rollenverständnis und Kulturkreis. Eine spezifische Bedeutung
kommt der aktuellen medizinischen Situation zu.
Die Beachtung des Sprachstils beim Patienten ist
für das gegenseitige Verstehen und das Begreifen seiner Welt- und
Gesellschaftswirklichkeit von Bedeutung. So weist bereits Wilhelm von HUMBOLDT
darauf hin, dass Unterschiede im Sprachstil nicht nur von Sprachbeherrschung,
Begabung oder intellektuellen Fähigkeiten abhängen, sondern von
der Ganzheit des Menschen bestimmt werden.
Dass die gleichen Worte je nach dem Lebensalter dessen,
der sie verwendet, völlig unterschiedliche Bedeutung besitzen können,
lässt sich sehr schön am Beispiel der Jugendsprache aufzeigen,
in der "arbeiten" nicht Broterwerb, sondern küssen oder knutschen
bedeutet, "ätzend" nichts mit Chemie zu tun hat, sondern der Begriff
für alles Schlimme, Üble darstellt, als "abgebaggert" jemand
bezeichnet wird, der körperlich und seelisch am Ende ist, und jemand
über 30 in die Kategorie der "Grufties" gezählt wird.
Sprachbesonderheiten, die für bestimmte Berufsgruppen
typisch und dort auch akzeptabel sind, haben im Gespräch zwischen
Arzt und Patient keinen Platz. Gerade die Technisierung der modernen Medizin
verleitet leicht dazu, Begriffe aus der Technikersprache, wie "umprogrammieren",
"abchecken", "Therapiekurs fahren", "Batteriewechsel", zu verwenden.
Ein anderes Extrem ist eine überzogen psychologisierende
Diktion, in der dann von "zielorientierter Kommunikation mit erotischer
Komponente und Tendenz zu emotioneller Fixierung" statt von "flirten" gesprochen
wird. Eine meiner Patientinnen, an deren Bett sich die zugezogene Psychotherapeutin
lang und breit über das "starke Über-Ich" verbreitete, konnte
schließlich nicht anders als mit der erlösenden Feststellung
zu reagieren (um endlich auch einmal zu Wort zu kommen): "Sie haben völlig
recht, Frau Doktor, manchmal kommt es ganz stark über mich."
Die soziale Wirklichkeit bestimmter Menschengruppen
prägt ihren Sprachstil oder Code. Code bedeutet eine für bestimmte
Gruppe von Menschen determinierte Weise, Vorstellungen sprachlich auszudrücken.
Codes sind daher "Soziolekte". Nach BERNSTEIN (zit. nach R. LAY) können
2 Sprechmuster (Codes) unterschieden werden:
-
ein entwickeltes Sprechmuster (elaborated code = EC)
und
-
ein beschränktes Sprechmuster (restricted code
= RC).
Hinsichtlich des Sprachverhaltens unterscheiden
sich EC und RC folgendermaßen:
-
Im EC wirkt die Sprache weniger stereotyp, die Ausdrucksweise
ist differenzierter;
-
im EC gelingt es leichter, individuelle Ansichten und
Wertungen auszudrücken;
-
im EC werden logische und sachliche Beziehungen ausdrücklich
herausgestellt;
-
im EC werden Über- und Unterordnungen sprachlich
prägnant wiedergegeben.
Den verschiedenen Sprechmustern können - zumindest
statisch gesehen - bestimmte soziale Verhaltensweisen zugeordnet
werden:
-
Dem RC entspricht eine mehr konventionelle, eher status-
als personenorientierte Verhaltensweise;
-
dem RC entspricht die Neigung, an erworbener Meinung
stur festzuhalten;
-
dem RC entspricht die Tendenz, mehr von Ängsten
als von Schuldgefühlen bestimmt zu werden:
-
dem RC entspricht eine mehr konservative als radikale
Neigung.
In Deutschland verwenden schätzungsweise 90% der
Erwachsenen einen EC. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der RC als "minderwertig"
eingestuft werden darf. Beide Codes sind als gleichgeordnete und gleichwertige
Sprachstile anzusehen. Intelligenz und Emotionalität können bei
ihren Benutzern gleichwertig entwickelt sein. Der Benutzer eines EC erlernt
allerdings in der Regel frühzeitig auch einen RC, während dies
umgekehrt praktisch nie der Fall ist.
Einen Sprachstil sollte der Arzt im Umgang mit seinen
Patienten besonders vermeiden: den Sprachstil vieler Politiker, der gekennzeichnet
ist durch die vollmundige und langatmige Formulierung von Null- oder Minimalinformationen.
Die nachfolgende Kostprobe verdeutlicht diesen Sprachcode am besten (Interview
im Februar 1985 mit dem Senator für Umweltschutz einer deutschen Großstadt
anlässlich beträchtlicher Arsenfunde).
Linus
Geisler: Arzt und Patient - Begegnung im Gespräch. 3. erw. Auflage,
Frankfurt a. Main, 1992
©
Pharma Verlag Frankfurt
Autorisierte
Online-Veröffentlichung: Homepage Linus Geisler - www.linus-geisler.de
|