| Online-Version des Referates
anlässlich der Veranstaltung: "Bedarfsgerechtigkeit im Gesundheitssystem?
Zur Lage chronisch kranker und behinderter Menschen nach der Gesundheitsreform"
- Gemeinsame Tagung von "Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft" (IMEW)
und "Katholische Akademie". Berlin, 7. September 2004.
Bedarfsgerechtigkeit im Gesundheitssystem?
"Konkordanter Bedarf"
als unverzichtbare Voraussetzung. Die Rolle des Arzt-Patient-Dialogs.
Linus S. Geisler
 Cartoons
stellen manchmal nicht die schlechteste Methode der Wirklichkeitsbeschreibung
dar. "Besteht noch Hoffnung??" fragt der offensichtlich schwerstkranke
Mann den Arzt an seinem Krankenbett. Dieser nimmt den Taschenrechner zur
Hand und antwortet mit schiefem Lächeln: "Wir rechnen’s mal durch!"
- Hier werden Patientenängste pointiert zum Ausdruck gebracht, die
in einem auf Rationierung und Effizienz ausgelegten Gesundheitssystem wurzeln. Cartoons
stellen manchmal nicht die schlechteste Methode der Wirklichkeitsbeschreibung
dar. "Besteht noch Hoffnung??" fragt der offensichtlich schwerstkranke
Mann den Arzt an seinem Krankenbett. Dieser nimmt den Taschenrechner zur
Hand und antwortet mit schiefem Lächeln: "Wir rechnen’s mal durch!"
- Hier werden Patientenängste pointiert zum Ausdruck gebracht, die
in einem auf Rationierung und Effizienz ausgelegten Gesundheitssystem wurzeln.
Solche Ängste sind nicht
völlig gegenstandslos. Die Ärztezeitung vom 2. August
2004 bringt auf der Titelseite "Gesundheitskasse rät zur Amputation
- Ärzte in Hessen empört" [1  ].
Der Artikel bezieht sich auf den Fall eines AOK-Mitarbeiters in Hessen,
der Ärzten allen Ernstes nahe gelegt hatte, einem Patienten lieber
beide Beine zu amputieren, statt ihn medikamentös und mit Hilfsmitteln
zu behandeln, weil die bisher verordneten Salben und Verbände wirkungslos
und somit "unwirtschaftlich" seien. ].
Der Artikel bezieht sich auf den Fall eines AOK-Mitarbeiters in Hessen,
der Ärzten allen Ernstes nahe gelegt hatte, einem Patienten lieber
beide Beine zu amputieren, statt ihn medikamentös und mit Hilfsmitteln
zu behandeln, weil die bisher verordneten Salben und Verbände wirkungslos
und somit "unwirtschaftlich" seien.
Eine wesentliche Konstituente
von Bedarfsgerechtigkeit im Gesundheitssystem liegt in der dialogischen
Beziehung zwischen Arzt und Patient. In dieser Dyade ist der Versuch einer
Annäherung von manchmal weit auseinander strebenden Wirklichkeiten
verortet. Eine Untersuchung von Slevin (1990) lässt die dramatische,
scheinbar kaum überbrückbare Kluft von Therapieoptionen zwischen
Krebspatienten und ihren Therapeuten erkennen [2]:
Entscheidungen von
Krebspatienten und deren Therapeuten für eine belastende Chemotherapie:
| . |
Patient |
Therapeut |
| Heilungschance |
1% |
10-50% |
| Lebensverlängerung |
12
Monate |
12-60
Monate |
| Symptombefreiung |
10% |
50-70% |
Tumorpatienten sind demnach
bereit, in einer nahezu aussichtslosen Situation eine belastende (und kostspielige)
Chemotherapie auf sich zu nehmen. Der Bedarf aus der Sicht schwerstkranker
Krebspatienten und der ärztlich-professionellen scheint kaum Berührungspunkte
aufzuweisen.
Welcher Bedarf zählt?
Bedarf kann als Zustand definiert
werden, dessen Behandlung durch spezifizierbare medizinische Maßnahmen
gesundheitlichen Nutzen erwarten lässt. Dabei muss Bedarf nicht regelhaft
mit der Krankheitsschwere anwachsen. So besteht beispielsweise in der Terminalphase
einer Tumorkrankheit zwar ein Bedarf an palliativen Maßnahmen, aber
nicht an Chemotherapie oder Strahlenbehandlung.
Bei der Bestimmung von Bedarfsgerechtigkeit
interferieren nach einem Modell der WHO im Prinzip drei Konzepte von Bedarf
(s. Abb.)
-
der wissenschaftliche Bedarf,
der beispielsweise auf evidenzbasierten oder epidemiologischen Daten basiert,
-
der professionelle Bedarf, dem
die Erfahrungen, aber auch die persönlichen Interessen des Arztes
zu Grunde liegen und
-
der subjektive ("gefühlte")
Bedarf des Patienten
Bedarfskonzepte in
der Medizin
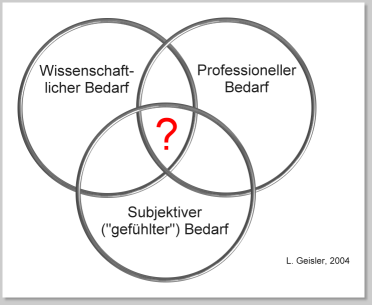
Keine dieser drei Bedarfskategorien
kann Anspruch darauf erheben, allen Anforderungen an ein umfassendes und
breit akzeptiertes Konzept von Bedarfsgerechtigkeit zu genügen. Damit
stellt sich die Frage nach einer Bedarfsform, die sich unter Gerechtigkeitsaspekten
am überzeugendsten begründen lässt. Ihre Idealform könnte
als "konkordanter Bedarf" beschrieben werden. Die Möglichkeiten einer
Annäherung an dieses Konzept werden im Folgenden entwickelt.
Der Mensch im Gesundheitssystem
Menschen sind im Gesundheitssystem
auf den drei Ebenen Mikro-, Meso- und Makroebene in unterschiedlichen Rollen
repräsentiert [3]:
-
als akut oder chronisch Kranke,
die eine wirksame Behandlung für ihre Erkrankung suchen (Mikroebene).
-
als Versicherte, die
sich gegen das Risiko Krankheit und die damit entstehenden Kosten absichern
wollen bzw. müssen (Mesoebene).
-
als Bürger, die
die Gewährleistung funktionierender Versorgungsstrukturen und gesundheitsförderlicher
Lebensbedingungen erwarten (Makroebene).
Der akut oder chronisch Kranke
kann wiederum als passiver Patient, als Partner im Gesundheitssystem oder
als Koproduzent (Kotherapeut) seiner Gesundheit verstanden werden. Je nach
dem Blickwinkel, unter dem Menschen im Gesundheitssystem betrachtet werden,
stehen demokratische, ökonomische, ethische oder medizinische Perspektiven
im Vordergrund. Die Fokussierung auf eine bestimmte Rolle präferiert
unterschiedliche Konzepte von Bedarfsgerechtigkeit.
Modelle der Arzt-Patient-Beziehung
– Wege zum "konkordanten" Bedarf
Die jeweilige Konfiguration
der Beziehung zwischen Arzt und Patient bestimmt, inwieweit Annäherungen
oder Übereinstimmung über medizinisches Wissen, persönlichen
Präferenzen, sowie diagnostische und therapeutische Entscheidungen
gefunden werden können.
Modelle der Arzt-Patienten-Beziehung
[4]
(nach E.J. Emanuel / L.L. Emanuel)
-
Paternalistisches Modell: auch
Eltern- oder Priestermodell. - Der Arzt weiß, was das Beste für
den Patienten ist
-
Informatives Modell: auch
technisches oder Konsumentenmodell. - Der Arzt fungiert als technischer
Experte, der dem Patienten fachliche Informationen als Entscheidungsgrundlage
bietet
-
Interpretatives Modell: der
Arzt als Berater und Begleiter des Patienten. - Der Arzt liefert Informationen,
hilft bei der Klärung von Wertvorstellungen und schlägt Maßnahmen
vor.
-
Abwägendes
Modell: der
Arzt als Lehrer und Freund. - Der Arzt bespricht sich mit dem Patienten
über die besten Handlungsmöglichkeiten.
|
|
Das paternalistische Modell
ist von einer asymmetrischen Verantwortungs- und Entscheidungsstruktur
geprägt, die einen Austausch von bedarfsbestimmenden Konstituenten
kaum zulässt. Das informative Modell bietet dem Patienten fachliche
Informationen als Entscheidungsgrundlage, verlagert aber die Entscheidungsverantwortung
weitestgehend auf die Schultern des ‚autonomen‘ Patienten. Das interpretative
und das abwägende Modell enthalten die größten Chancen,
dass unter Einbeziehung der Präferenzen und Wertvorstellungen des
Patienten ein Bedarfskonzept herausgearbeitet wird, das sozusagen die Handschrift
beider Partner der Dyade Arzt-Patient trägt.
Partizipative Entscheidungsfindung
(PEF)
Partizipative Entscheidungsfindung
ist ein interaktiver Prozess zwischen Patient und Arzt mit dem Ziel, unter
gleichberechtigter und annähernd gleichgewichtiger Beteiligung beider
und auf der Basis geteilter Informationen zu einer gemeinsam verantworteten
Übereinkunft zu kommen [5  ].
Die so gewonnene Übereinkunft wird als
Concordance (Konkordanz)
bezeichnet. ].
Die so gewonnene Übereinkunft wird als
Concordance (Konkordanz)
bezeichnet.
Arzt-Patient-Beziehungen
sind ihrer Natur nach asymmetrisch. Fast immer besteht eine Schieflage
von Entscheidungs- und Verantwortungspotential. Methoden der partizipativen
Entscheidungsfindung können diese Asymmetrie nicht gänzlich aufheben,
allerdings auf ein Maß reduzieren, auf dem die Kommunikationspartner
in einem Klima des gegenseitigen Respekts und Vertrauens eine gemeinsame
Entscheidung aushandeln können.
Aus Systemtheoretischer Sicht
werden Informationen als Selbstorganisationsleistung des psychischen Systems
verstanden. Im Prozess der partizipativen Entscheidungsfindung kommuniziert
der Arzt seine Wirklichkeitskonstruktion und der Patient entwickelt dem
Arzt gegenüber eine Konstruktion seiner krankheitsbezogenen Wahrnehmung.
Da Shared-Decision-Making-Situationen durch ein hohes Maß
an inhärenter Ungewissheit gekennzeichnet sind, ist eine Evidenz "richtige"
oder "falsche" Entscheidung nicht begründbar [6].
Die erzielte Übereinstimmung,
die
Concordance (Konkordanz), bildet die Matrix für die gemeinsamen
Handlungsentscheidungen und die daraus resultierende Adherence (Adhärenz),
die als Maß für den Umfang gilt, in welchem der Patient sich
in einem therapeutischen Prozess an Anweisungen und Verordnungen hält.
Der Begriff Adherence ersetzt im angelsächsischen Sprachraum
zunehmend den Begriff Compliance, der auch Elemente der Fügsamkeit
und Unterwürfigkeit beinhaltet, die mit der Selbstbestimmung des Patienten
konfligieren.
Shared Decision Making
(SDM)
Das in den USA und zunehmend
auch bei uns favorisierte Modell des "Shared Decision Making" [7  ]
versetzt in einem schrittweisen ]
versetzt in einem schrittweisen
-
Informations-,
-
Diskurs- und
-
Vertrauensbildungsprozess
Patient und Arzt in die Lage,
-
gemeinsame Therapieziele zu
definieren
-
zu erreichen und
-
zu verantworten.
Um zu einer shared decision
zu kommen, müssen sich Patient und Arzt Wissen und Wertvorstellungen
gegenseitig mitteilen. Ein wichtiger Aspekt des ärztlichen Gesprächs
beim shared decision making besteht darin, dem Patienten zu helfen seine
Wertvorstellungen, Präferenzen und Wünsche zu konkretisieren
und zu artikulieren. Der Arzt wiederum informiert in einer für den
Patienten angemessenen Weise über die fachlichen Hintergründe.
Der Arzt bleibt Experte für das Wissen, der Patient wird als Experte
für seine Präferenzen anerkannt. Eine Therapieentscheidung wird
zwischen beiden "Experten" einvernehmlich gesucht, aber auch die Verantwortung
wird geteilt [8  ].
Damit wird die traditionell ungleiche Verantwortungsteilung der Arzt-Patient-Interaktion
überwunden. ].
Damit wird die traditionell ungleiche Verantwortungsteilung der Arzt-Patient-Interaktion
überwunden.
Die Mitwirkung des Patienten
bei Therapieentscheidungen ist auch durch das Selbstbestimmungsrecht garantiert.
Das Bundesverfassungsgericht weist darauf hin, dass dieses Recht ein "wesentlicher
Teil des ärztlichen Aufgabenbereichs" ist. Die Mitwirkung des Patienten
erschöpfe sich nicht in der "in passiver Haltung erteilten bloßen
Einwilligung in ärztlicherseits gebotene Behandlungsvorschläge"
[9].
Im Shared-Decision-Making-Modell
(SDM-Modell) steht das Dialogische der Arzt-Patient-Beziehung ganz
im Mittelpunkt. Dieses vermag nicht nur aus medizinischer, sondern auch
aus sozialethischer und ökonomischer Sicht Wesentliches zu leisten.
Hier wird der Kranke nicht fragmentiert, sondern in eine fruchtbare partnerschaftliche
Beziehung eingebunden. Die "erlernte Kompetenz" des Arztes wird mit der
"gelebten Kompetenz" des Patienten in Einklang gebracht [10].
Das SDM-Prinzip erweist sich
dort am wirksamsten, wo die Urteilsfähigkeit des Patienten möglichst
hoch und der Krankheitsverlauf chronisch ist (Isfort et al. [11]). Dies
gilt heute praktisch für das Gros der Krankheiten (s. Abb.).
Shared Decision Making
(mod.
nach J. Isfort et al., 2002)
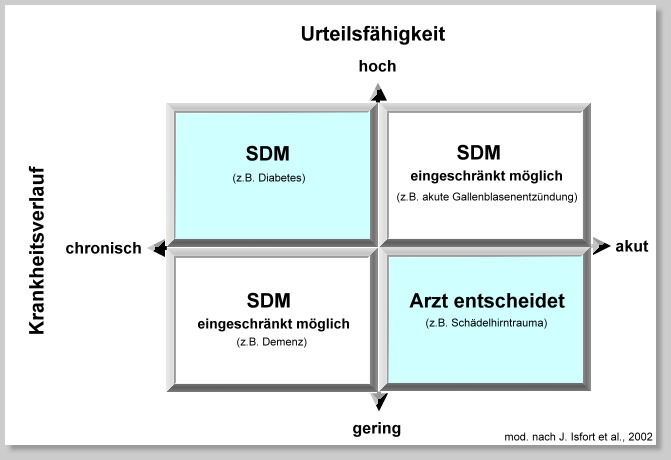
Entscheidungssituationen, in
denen Shared-Decision-Making vor allem förderlich erscheint, nennt
Charles [aaO. 7  ],
von dem das Konzept stammt: ],
von dem das Konzept stammt:
-
Entscheidungen bei potenziell
lebensbedrohlichen Krankheiten
-
Entscheidungen, bei denen verschiedene
Behandlungsalternativen mit potentiell unterschiedlichen Resultaten zur
Diskussion stehen
-
Bei fehlender eindeutiger Evidenz
für medizinisches Handeln
-
Wenn individuelle Präferenzen
bei unterschiedlichen Therapiemaßnahmen große Bedeutung für
die Lebensqualität besitzen (z.B. Mammakarzinom).
Das Interaktionsmodell des Shared-Decision-Making
erscheint geeignet, durch den Versuch der gegenseitigen Einbeziehung, Bewertung
und Respektierung der Wirklichkeitsaspekte von Patient und Arzt das Konzept
der Bedarfsgerechtigkeit um die bisher unterrepräsentierte, aber unter
Gerechtigkeitsaspekten unverzichtbare Perspektive eines partnerschaftlich
partizipierenden Patienten zu erweitern.
Die Auswirkungen von Shared-Decision-Making
auf die tatsächliche Entscheidungsfindung oder auf ökonomische
Einspareffekte sind allerdings noch nicht abschließend evaluiert.
Vielfach wird die explizite Herstellung von Beziehung in der Behandlungsdyade
als das Wesen von SDM verstanden.
Gesundheitsreform: Killer
für das Arzt-Patient-Verhältnis?
Das Kölner Meinungsforschungsinstitut
ifm
hat im September 2004 in Tiefeninterviews mit niedergelassenen Ärzten
und Patienten die Auswirkungen der Gesundheitsreform auf die Arzt-Patient-Beziehung
untersucht [12  ].
Resultat: "Durchgängiges Misstrauen und unterschwellige Umverteilungskämpfe
haben im Arzt-Patienten-Verhältnis Einzug gehalten." Die Gesundheitsreform
wird als Killer für das Arzt-Patient-Verhältnis tituliert. Vier
typische Reaktionen von Ärzten auf die Gesundheitsreform wurden ausgemacht: ].
Resultat: "Durchgängiges Misstrauen und unterschwellige Umverteilungskämpfe
haben im Arzt-Patienten-Verhältnis Einzug gehalten." Die Gesundheitsreform
wird als Killer für das Arzt-Patient-Verhältnis tituliert. Vier
typische Reaktionen von Ärzten auf die Gesundheitsreform wurden ausgemacht:
-
Der "frustrierte Ethiker" lehnt
die ökonomische Ausrichtung seines Tuns ab. Er begegnet dem Patienten
weiterhin als objektiver, kompetenter Fachmann
-
Der "Bindungsunsichere" fürchtet
die Enttäuschungen der Patienten. Er will Stammpatienten wie gehabt
versorgen, erklärt ihnen freundlich Leistungsreduktionen
-
Der "störrisch Gekränkte"
leidet unter der empfundenen Statusabwertung und den Eingriffen in die
Verordnungsfreiheit. Er verweist auf die Verursacher der Misere und behandelt
die Patienten streng nach den neuen Vorschriften.
-
Das "Verkaufstalent" betrachtet
die Ökonomisierung als Chance und baut den Absatz von Zusatz- und
Sonderleistungen aus.
Eine Verallgemeinerung dieser
Ergebnisse ist wegen der relativ kleinen Fallzahl nicht angebracht. Aber
die Studie macht ein großes Versäumnis der Gesundheitsreform
deutlich: Sie vermittelt Ärzten und Patienten kein handhabbares gesellschaftliches
Maß oder Leitbild, von dem aus medizinisch Notwendiges und wirtschaftlich
Sinnvolles bestimmbar sind. So müssen beide Seiten das Maß "für
den neuen Umgang mit Erkrankungen nun unter ungünstigen Voraussetzungen
miteinander aushandeln." Dies bedeutet eine thematische Ausweitung des
Arzt-Patient-Dialogs, da in die partizipative Entscheidungsfindung die
ökonomischen Auswirkungen der Gesundheitsreform einbezogen werden
müssen.
Auf diesem Feld sind viele
Ärzte noch ungeübt. Die Einbeziehung ökonomischer Kriterien
bei Therapieentscheidungen betrachten Ärzte überwiegend als "unmoralisch",
wie langfristig angelegte Ethikprojekte in deutschen Kliniken (Nürnberg,
Hamburg) zeigen, wo Konfliktlösungen zwischen der Kultur des Ethos
der Heilberufe und der Kultur eines ökonomisch denkenden Managements
erarbeitet werden. In diesen Projekten wird versucht Ethik-Kodes zu entwickeln,
die Ärzten und Pflegenden helfen, die Balance zwischen Ethik und Wirtschaftlichkeit
zu finden [13  ]. ].
Die Anforderungen an die
dialogischen Fähigkeiten von Ärzten im Bemühen um die Bestimmung
eines "konkordanten Bedarfs", erhöhen sich damit nicht unbeträchtlich.
Ein Grund mehr, die Förderung
von kommunikativer und psychosozialer Kompetenz von Anfang an im Medizinstudium
in gebührendem Umfang zu verankern.
Bedarfsgerechtigkeit im
Gesundheitswesen
Bedarfsgerechtigkeit im Gesundheitswesen
wird nach der neuen Gesundheitsreform rudimentär bleiben, wenn sie
nicht auf einen konkordanten Bedarf abzielt, sondern dem Patienten lediglich
eine untergeordnete Nebenrolle zuweist. Neben wissenschaftlichen und professionellen
Bedarfsvorstellungen umfasst konkordanter Bedarf auch die in einem partizipativen
Entscheidungsprozess zwischen Patient und Arzt ermittelten Ansprüche,
Rechte und Pflichten des Patienten.
Der schrittweise Informations-,
Diskurs-, und Vertrauensbildungsprozess des SDM, an dessen Ende eine gemeinsam
getroffene und verantwortete Entscheidung stehen kann, erfordert vom Arzt
die Bereitschaft und Geduld, Fachwissen mit dem Patienten zu teilen, es
verständlich darzustellen und zu diskutieren. Er soll den Patienten
ermutigen und stimulieren, Bedenken und Beschwerden zu formulieren und
seine Bereitschaft fördern, eigene Präferenzen deutlich zu machen.
Idealerweise entwickelt sich dabei eine Beziehung, in der beide sich vertrauensvoll
auf einander einlassen und verlassen. Bedarfsgerechtigkeit, die diesen
Namen verdient, ist ohne die dargestellten dialogischen Bemühungen
eine Begriffshülse mit Verfallsdatum.
Literatur:
[1] Ärztezeitung vom
2. August 2004 (Titelseite): Gesundheitskasse rät zur Amputation -
Ärzte in Hessen empört.
URL: http://www.aerztezeitung.de/docs/2004/08/02/143a0102.asp?cat= 
[2] Slevin ML, Stubbs L,
Plant HJ, et al. Attitudes to chemotherapy: comparing views of patients
with cancer with those of doctors, nurses, and general public. BMJ 1990;
300: 1458-1460
[3] Schwartz FW, B Badura,
R Busse, R Leidl, H Raspe, J Siegrist, U Walter (Hg.): Public Health -
Gesundheit im Gesundheitswesen. München - Jena. 2003. S. 315
[4] Emanuel EJ, LL Emanuel:
Four Models of the Physician-Patient Relationship. JAMA 267:2221-6, 1992
Übersicht z.B. unter
URL: http://www.msu.edu/course/hm/546/ft1-4.htm 
[5] Klemperer D: Wie Ärzte
und Patienten Entscheidungen treffen. Konzepte der Arzt-Patient Kommunikation.
Berlin 2002
Abstract-URL + Link zum
kostenfreien PDF-Download des Artikels: http://www.wz-berlin.de/ars/ph/abstracts/abstracts_deutsch/sp_i_2003-302.de.htm 
[6] Kasper J, Chr Kuch, Ch
Heesen: Shared decision-making als Interaktionsstil. In: Scheibler F, H
Pfaff: Shared Decision-Making. Der Patient als Partner im medizinischen
Entscheidungsprozess. Weinheim und München. 2003. S. 34-46
[7] Charles C, Gafni A, Whelan
T.: Shared decision-making in the medical encounter: what does it mean?
(or it takes at least two to tango). Soc Sci Med 1997; 44:681-692
Abstract-URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=9032835 
[8] Büchi M, Bachmann
L M, Fischer J E, Peltenburg M, Steurer J: Alle Macht den Patienten? Vom
ärztlichen Paternalismus zum Shared Decision Making. Schweizerische
Ärztezeitung. 2000; 81: Nr. 49, 2776-2780
PDF-Download: http://www.saez.ch/pdf/2000/2000-49/2000-49-1017.PDF 
[9] BVerfGE 52, 131, 170
[10] M-L Dierks, FW Schwartz:
Patienten, Versicherte, Bürger - Nutzer des Gesundheitswesens. In:
FW Schwartz (Hg): Das Public Health Buch. München - Jena. 2. Aufl.
2003
[11] Isfort J, B Floer, N
Koneczny, HC Vollmar, M Butzlaff: „Shared Decision Making“. Arzt oder Patient
- Wer entscheidet? Dtsch Med Wochenschr. 2002;127:2021-2024
[12] Ärztezeitung vom
3./4. September 2004, S. 8: Wie Ärzte auf wachsendes Misstrauen reagieren.
URL: http://www.aerztezeitung.de/docs/2004/09/03/157a0802.asp?cat= 
[13] Wehrkamp KH: Brücke
zwischen Qualität und Ökonomie. Deutsches Ärzteblatt, Jg.
101, Heft 36, 3. September 2004. Ausgabe C. S. 1923-1927
URL: http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=43184 
|
|
| Linus S. Geisler: Bedarfsgerechtigkeit
im Gesundheitssystem? - "Konkordanter Bedarf" als unverzichtbare Voraussetzung.
Die Rolle des Arzt-Patient-Dialogs. |
| Online-Version des Referates
anlässlich der Veranstaltung: "Bedarfsgerechtigkeit im Gesundheitssystem?
Zur Lage chronisch kranker und behinderter Menschen nach der Gesundheitsreform"
- Gemeinsame Tagung von "Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft" (IMEW)
und "Katholische Akademie". Berlin, 7. September 2004. |
| URL dieses Vortrags: http://www.linus-geisler.de/vortraege/0409bedarfsgerechtigkeit.html |
|